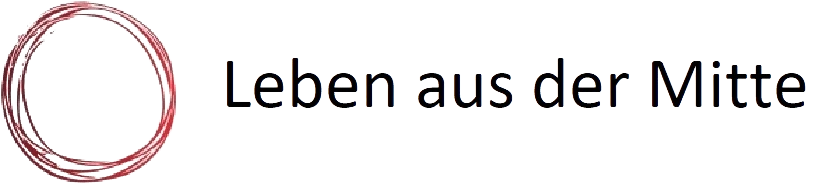Heute melde ich mit ein paar Gedanken zum Sonntagsevangelium. Wir hören von der Tempelreinigung Jesu. Während Matthäus, Markus und Lukas diese Geschichte am Ende des Wirkens Jesu erzählen, berichtet Johannes davon schon ganz am Anfang im 2. Kapitel, gleich nach der Hochzeit in Kana. Diese zwei Erzählungen sind wie Leitmotive des Lebens Jesu, die Johannes dann in den folgenden Kapiteln entfaltet. Und diese beiden Motive gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Einmal geht es um Freude und Liebe. Das Wirken Jesu beginnt mit einer Hochzeit – schon im AT ein Bild für die innige Beziehung zwischen Israel und Jahwe. Das Hohelied der Liebe, das von der Sehnsucht der Braut nach dem Bräutigam erzählt, lässt sich als eine Metapher für die Beziehung der Seele zu Gott deuten. Gott will mit mir in Verbindung kommen, in eine Liebesbindung und er will mein Leben, so wie es ist, wandeln, wie das Wasser in Wein.
Das andere Leitmotiv ist Reinigung und Klarheit: Wo Jesus auftritt, scheiden sich die Geister und es wird offenbar, was uns wirklich bewegt und welch Geistes Kind wir sind. Jesus lässt sich nicht vom Schein täuschen, er unterscheidet heilig von scheinheilig, lebendig von innerlich schon gestorben. Scheinbar machen die Händler und Priester ja genau das, was Gott gerne will; doch Jesus deckt auf, dass das Tempelpersonal in seinen Routinen gefangen ist und in dieser heiligen Geschäftigkeit auch ohne Gott ganz gut auskommt. Damit aber ist alles pervertiert. Und das treibt Jesus das Blut in die Adern und er wird zornig, ja sogar gewalttätig. Der Tempel und das leere Allerheiligste sind Platzhalter für die unfassbare geheimnisvolle Gegenwart Gottes unter den Menschen – und kein Mensch darf sich anmaßen, dieses Geheimnis beherrschen oder verwalten zu können oder daraus für sich selbst Profit herauszuschlagen.
Es wäre spannend die Geschichte der Tempelaustreibung mit der aktuellen Kirchensituation in Verbindung zu bringen und kritisch zu fragen, wo die Kirche vergessen hat, dass sie nur ein Instrument ist, Einheit zwischen Gott und den Menschen zu stiften (Lumen Gentium 1) und sich stattdessen zum Selbstzweck erklärt hat. Ich möchte aber einen anderen Weg verfolgen und mich an einer Auslegung von Johannes Tauler anlehnen. Der Mystiker des 14. Jahrhunderts schaut nicht auf die Kirche, sondern auf den Einzelnen. Für ihn ist der Tempel ein Bild für den Menschen, der – wie Paulus sagte – Tempel des Heiligen Geistes ist.
Tauler erinnert uns daran, dass Gott in unserem Inneren wohnt. Es gibt einen inneren Ort, bei dem ich ganz bei mir selbst bin und ganz bei Gott. Doch damit wir aus diesem innersten Seelengrund und aus Gott leben, muss alles Nebensächliche, das uns davon abhält, losgelassen werden. In den Worten des Bibeltextes: Die inneren Käufer und Händler, d.h. der Ungeist der Eigensucht und des Habenwollens, der Gier und des Geltungsdrangs müssen aus dem Tempel der Seele vertrieben werden. Dafür müssen wir üben, immer wieder unseren Blick aus der Zerstreuung auf Gott lenken. „Dann werden wir wahre Kinder Gottes, die Gott darum wissen, dass Gott in unserem innersten Seelengrund am Wirken ist.“ Ansonsten haben wir nur „einen gedachten und gemachten Gott“, aber sind nicht mit dem Lebendigen verbunden.
Wer sich der Gegenwart Gottes gewiss ist, der findet eine innere Stabilität und wird durch Geschehnisse nicht verunsichert und abgelenkt. Er kann nicht „ent-friedet“ werden, wie Tauler das ausdrückt.
Aber da wir uns der inneren Gegenwart Gottes so oft nicht bewusst sind, müssen wir uns immer wieder neu dafür öffnen und– bildlich gesprochen – die Krämer, die mit ihrem (Klein-) Kram in unseren Tempel hereinkommen und sich niederlassen wollen, zur selben Tür hinausbegleiten, durch die sie gekommen sind. Es geht dabei nicht um fromme Gefühle, die sind zweitrangig, sagt Tauler, es geht um die Verbindung unseres Gemüts mit Gott.
Ich finde, dass Taulers Auslegung der Tempelreinigung zur Fastenzeit gut passt. Es ist die Zeit, der inneren Reinigung und Neuausrichtung. Sie lädt uns ein, loszulassen, was nicht wesentlich ist: nicht nur äußere Dinge, sondern auch innere Gedanken, Bilder und Gewohnheiten. Das stellt an mich die Frage, woran ich mich festklammere und was ich loslassen könnte.
Loslassen kann ich aber nur, wenn ich weiß, dass ich nichts ins Nichts falle. Ich brauche also das Vertrauen, im Letzten gehalten zu sein. Das kann ich nicht einfach machen, aber doch immer wieder einüben und neu versuchen. Und das ist noch viel wichtiger.
Es gibt viele Wege, Gott zu glauben, d.h. zu vertrauen. Dafür braucht es explizite Zeiten, die allein der Beziehung zu Gott gewidmet sind. Dem dienen religiöse Übungen und Rituale, sei es das mündliche Gebet, das Still-da-sein vor Gott, die Feier des Gottesdienstes, das Lesen der Bibel und theologischer Bücher. Alle diese expliziten Gebetszeiten zielen darauf hin, dass ich mein gesamtes Leben im Lichte Gottes sehen kann und seine Gegenwart in allem, was ich tue und erlebe aufspüre. Dieses Wissen um seine Gegenwart ist das eigentliche Gebet.